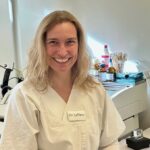
„Viele wissen nicht, dass es Alternativen gibt“ – bessere Aufklärung bei Hörverlust ist wichtig
Experteninterview
Frau PD Dr. Wiebke Laffers ist niedergelassene Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und seit vielen Jahren auf die Versorgung von Menschen mit Hörverlust spezialisiert.
Was einst mit dem Aufbau einer Abteilung für Hörimplantate an der Universitätsklinik Bonn als große Herausforderung begann, wurde zu ihrer Leidenschaft. Im Interview spricht Dr. Laffers über Hindernisse in der Hörversorgung und notwendige Veränderungen
Frau Dr. Laffers, Sie haben sich als HNO-Ärztin im Laufe der Jahre zur Spezialistin für die Versorgung von Menschen mit Hörverlust entwickelt. Wann hat diese Entwicklung begonnen?
Ein prägender Moment war für mich, als Prof. Dr. Gerstner, damals leitender Oberarzt in der Universitätsklinik in Bonn, auf mich zukam und mich bat, eine Abteilung für Hörimplantate aufzubauen. Damals kam das für mich völlig unerwartet. Ich hatte vorher nur vage von der Möglichkeit der Versorgung mit Hörimplantaten gehört, sagte aber zu, ohne lange zu zögern. Dann kamen die ersten Patientenkontakte – und ich wusste, dass dieser Schritt für mich der richtige war.
Welche Fälle haben Sie besonders bewegt?
Da gibt es viele! Ich erinnere mich an die Operation eines 1-jährigen Kindes, das ein Cochlea-Implantat bekam. Als der Prozessor zum ersten Mal eingeschaltet wurde, war ich dabei. Dieser Aha-Moment, wenn jemand zum ersten Mal Stimmen hört oder auf einem tauben Ohr plötzlich Geräusche wahrnimmt – das sorgt für Gänsehaut bei allen, die es miterleben.
Schätzungen besagen, dass rund 10 bis 15 Prozent aller Hörgeräteträger in Deutschland eigentlich Kandidaten für ein Hörimplantat wären.
Es gibt in der Tat viele Menschen, die von einer Versorgung mit Hörimplantaten profitieren könnten. Leider werden sie oft nicht darüber informiert. Während meiner Zeit in der Klinik habe ich häufig Patienten gesehen, die jahrelang mit unzureichenden Hörgeräten gelebt haben, weil ihnen nie eine Alternative aufgezeigt wurde. Besonders in ländlichen Regionen ist das ein Problem.
Warum erfahren nicht alle betroffenen Patienten mit starker Höreinschränkung oder mit Hörverlust von der Möglichkeit einer Implantat-Versorgung?
Ein großes Hindernis ist die begrenzte Zeit in den Praxen. Niedergelassene HNO-Ärzte haben oft nur jeweils wenige Minuten je Patient zur Verfügung, sodass eine ausführliche Beratung schwer umzusetzen ist. Dauert ein Termin länger, z. B. wegen einer Beratung zur Hörversorgung, wird das von den Kassen nicht adäquat vergütet. Viele Praxen setzen gezwungenermaßen auf schnelle, abrechenbare Diagnostik, anstatt sich mit den Hörproblemen der Patienten auseinanderzusetzen.
Wie könnte das Bewusstsein für Hörimplantate gestärkt werden?
Aufklärung ist entscheidend – sowohl auf ärztlicher als auch auf Patientenseite. Informationskampagnen könnten helfen. Aber auch die Zusammenarbeit zwischen HNO-Ärzten, Hörakustikern und Kliniken müsste verbessert werden. In meiner aktuellen Praxis halte ich z. B. Vorträge für betroffene Patienten, um sie gezielt zu informieren. Wenn Menschen früher erkennen, dass eine Versorgung mit Hörgeräten nicht mehr ausreicht und dass es Alternativen gibt, kann vielen geholfen werden.
Welche Fehler begegnen Ihnen häufig in der Hörversorgung?
Hörgeräte werden – anders als Brillen – immer noch als Stigma empfunden. Betroffene warten oft zu lange, bis sie sich Hilfe suchen. Der Hörverlust ist dann eventuell schon weit fortgeschritten, obwohl es effektive Lösungen gibt. Ein weiteres Problem ist eine fehlerhafte Anpassung von Hörgeräten. Viele meiner Patienten kommen zu mir, weil ihre Geräte nicht richtig eingestellt sind oder es einfach nicht die richtigen Hörgeräte für den jeweiligen Patienten sind – dann liegen sie ungenutzt in der Schublade. Das ist eine Fehlversorgung, die Geld kostet und den Patienten nicht hilft.
Welche Widerstände erschweren die Versorgung mit Hörimplantaten?
Zum einen fehlt es an Wissen: Viele niedergelassene HNO-Ärzte und Hörakustiker sind nicht auf dem neuesten Stand, wenn es um moderne Implantat-Technologien geht. Zum anderen haben Patienten oft Berührungsängste, weil sie sich nicht vorstellen können, wie ein Implantat funktioniert oder weil sie Angst vor einem Eingriff haben.
Wie nehmen Sie Betroffenen die Angst vor einem Cochlea-Implantat?
Aufklärung ist das A und O. Ein wesentlicher Punkt ist aber auch, den Patienten Zeit zu geben, Fragen zu stellen und diese ausführlich zu beantworten. Viele stellen sich ein Implantat z. B. viel größer vor, als es tatsächlich ist. Oder sie haben falsche Vorstellungen davon, wo das Implantat eingesetzt wird – „im Kopf“. Ich erkläre ihnen genau, wie es funktioniert, zeige die Modelle und nehme mir Zeit für die Fragen der Patienten. Sobald sie verstehen, dass das Implantat nicht im Gehirn, sondern nur unter der Haut sitzt, sind die meisten beruhigt.
Gab es Fälle, in denen eine falsche Hörversorgung große Probleme verursacht hat?
Ja, das passiert leider immer wieder. Manche Patienten bekommen Hörgeräte, die für ihre individuelle Hörsituation nicht geeignet sind. Das führt dazu, dass sie die Geräte nicht nutzen und ihr Hörverlust unversorgt bleibt. Das wiederum kann soziale Isolation und damit einhergehend auch psychische Probleme verursachen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Hörversorgung?
Ich wünsche mir, dass mehr Menschen früher Zugang zu einer optimalen Hörversorgung erhalten. Auch die Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen HNO-Ärzten, Akustikern und Kliniken sollte verbessert werden. Zudem wäre es wichtig, dass Akustiker noch individueller auf die Patienten eingehen und ihnen nicht nur eine Standardlösung anbieten. Und natürlich muss das Bewusstsein für die Bedeutung des Hörens in der Gesellschaft weiter steigen – denn wer gut hört, bleibt länger geistig fit und aktiv.
Für neue Updates anmelden
Durch die Anmeldung für unseren Newsletter bleiben Sie über bewährte Verfahren in der Hörimplantat-Technologie auf dem Laufenden.

 Zurück
Zurück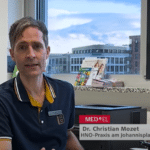 Experteninterview
Experteninterview 
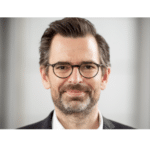 Experteninterview
Experteninterview